
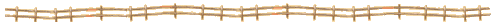
PROLOG
Der Maultierhirsch
hob witternd den schlanken Kopf und prüfte mit seinen schwarz glänzenden
Nüstern den Wind. Seine dunklen Augen glitzerten in den Sonnenstrahlen, die die
Baumwipfel in schmalen Bahnen durchdrangen, und sein Geweih durchstach die laue
Luft, als er keck den Kopf empor warf und sich umsah. Noch einmal nahm er die
Gerüche auf, die der Wind mit sich trug. Vogelgezwitscher erfüllte die Luft mit
einer Vielzahl von Stimmen, und das immerwährende Summen unzähliger Insekten
bildeten eine friedvolle Atmosphäre. Nichts störte das Idyll. Das braun
schimmernde Fell seiner Flanke zuckte, und mit seinem Wedel vertrieb der Bock
einige vorwitzige Fliegen. Dann stampfte er mit einem Vorderlauf auf, senkte
den Kopf, beruhigt, und äste weiter.
Das leise Surren
war kaum lauter als der Flügelschlag einer Biene und traf dennoch mit tödlicher
Präzision sein Ziel. Der Maultierhirsch bäumte sich auf, wollte fliehen, aber
es war bereits zu spät. Zitternd brach er zusammen. Sein linker Vorderlauf
zuckte noch einmal, dann lag er still. Der gefiederte Schaft eines Pfeils ragte
aus seiner Seite, einziges sichtbares Zeichen dessen, was geschehen war.
Der Jäger erhob
sich und näherte sich langsam der Beute, wobei er die Umgebung ebenso sorgsam
beobachtete wie der Bock es zuvor getan hatte. Eine weitere Gestalt schälte
sich aus dem Unterholz, dann noch eine, bis alle Mitglieder des kleinen
Jagdtrupps sich um das erlegte Wild versammelt hatten.
"Wicistá kiŋ ciyéwayekiŋ wanása el wašteya
heca. Das Auge meines älteren Bruders bei der Jagd ist gut", stellte
Kleiner Bär voller Anerkennung aber ohne Neid fest. Wolfsauge nickte ihm zu.
Dann öffnete er die Halsschlagader und ließ das Blut des Tieres als Opfer für
die Götter in die Erde fließen, während er ein leises Gebet für die Seele des
getöteten Tieres sprach. Hier unterschieden sich seine Bräuche von denen seiner
Brüder, doch sein Vater hatte es ihm so beigebracht. Aber das Tier war für sie
gestorben und verdiente es, geehrt zu werden, zumindest darin waren sie sich
einig.
Mit schnellen
Schnitten öffneten sie dann die Beute und aßen die noch warme Leber.
Anschließend schlugen sie den Kadaver in eine mitgebrachte Haut ein, um ihn
während des Transportes vor den Fliegen zu schützen. Häuten und zerteilen
würden sie ihn nicht mehr. Heute war bereits der dritte Tag der Jagd, und sie
hatten genügend Beute gemacht, um den Stamm einige Wochen lang mit Wild zu versorgen.
Die Beute der ersten beiden Tage, in dünne Streifen geschnitten, war schon
beinahe getrocknet, und um das frische Fleisch würden sich am Abend die Frauen
kümmern.
"Nitawicu kiŋ el iluškiŋyaŋ hwo? Freust
du dich auf deine Frau?", wollte Kleiner Bär mit einem gespielt lüsternen
Grinsen wissen, und Wolfsauge versetzte ihm einen freundschaftlichen Schlag gegen
die Schulter.
"Mitawicu kiŋ el ibluškiŋyaŋ líla slolyáye
yelo. Du weiß, wie sehr ich mich auf meine Frau freue", entgegnete er
dann. Kleiner Bär hatte nichts anderes erwartet. "Geht mit den
Wolken" war Kleiner Bärs Schwester, und er wusste, wie verliebt die beiden
noch immer ineinander waren. Seit vier Jahren waren sein bester Freund und Blutsbruder
und seine Schwester ein Paar. Ihre beiden Söhne verbrachten beinahe soviel Zeit
bei ihrem Onkel wie bei ihren Eltern, besonders, wenn die Eltern ein wenig Zeit
für sich allein haben wollten.
Kleiner Bär fragte
sich, ob sein Leben mit Omášte ebenso verlaufen würde. Wenn sie von der Jagd
zurück waren, würde er ihrem Vater sein Angebot unterbreiten, und er war sich
sicher, es würde Gehör finden. Sonnenschein war die schönste Frau, die er jemals
gesehen hatte. Nicht mehr lange, und sie würde die Seine werden. Sie würden ein
Tipi teilen und viele starke und gesunde Söhne miteinander haben.
Ein zufriedenes
Lächeln huschte über sein Gesicht bei dem Gedanken, und er erhaschte Wolfsauges
Grinsen, als dieser ihn wissend musterte.
"Luħa léce yo. Grins du nur",
knurrte er. "Wakeya nitáwa kiŋ el nitawicu
kiŋ luha. Haŋhépi išnála ilštíŋma sŋi. Caŋténiwašte. Du hast deine Frau in
deinem Zelt. Du schläfst nachts nicht allein. Du bist glücklich."
Dann machten sie
sich daran, die Beute auf die Travois zu verladen.
"Hast du
schon jemals mit dem Gedanken gespielt, zu den weißen Männern
zurückzukehren?", fragte Kleiner Bär, während sie langsam nebeneinander
her ritten. Die Jagdgruppe bestand aus fünf jungen Männern des Dorfes. Das
Frühjahr war trocken gewesen, und auch wenn es in der Nähe des Sommerlagers
noch ausreichend Wild gab, zogen die jungen Männer dennoch hin und wieder aus,
um zu jagen.
"Warum sollte
ich?", gab Wolfsauge zurück. "Ich bin glücklich bei meinen Brüdern."
"Und vermisst
du nicht die Wege des weißen Mannes?"
Wolfsauge
schnaubte. "Da gibt es nicht viel zu vermissen, glaub mir."
"Ich dachte
immer, eines Tages wirst du uns verlassen."
"Warum?"
Erstaunt sah Wolfsauge ihn an.
"Die Geister
zeigten es mir in einem Traum", erwiderte Kleiner Bär.
"Zeigten sie
dir auch, warum?"
Kleiner Bär
schüttelte den Kopf. "Nein. Nur, dass eine große Traurigkeit dich
bedrückte." Er blickte auf seine Hände. "Eine große Traurigkeit, die
uns alle bedrückte."
"Und warum
erzählst du mir das ausgerechnet jetzt?"
Kleiner Bär sah
ihn an. "Weil die Geister mir den Traum in der letzten Nacht noch einmal
sandten."
"Das ist doch
Unsinn. Das ist…" Er brach ab, als ein Aufschrei vom Kopf der Truppe sie
erreichte. Ohne zu zögern, grub er seinem Pony die Fersen in die Flanken, und
das drahtige Tier jagte los, den leichten Hügel hinauf. Wolfsauges Herz
hämmerte wie rasend, beinahe im Gleichklang mit dem Takt der wirbelnden Hufe
seines Reittieres. Auf der Kuppe des Hügels angekommen brachte er sein Pferd
zum Stehen. Mit ungläubigem Blick erfasste er das Bild, das sich seinen entsetzten
Augen präsentierte.
Sein Herz zog sich
schmerzhaft zusammen, während sein Verstand sich weigerte, das zu akzeptieren,
was seine Augen ihm zeigten. Es war einfach unmöglich, zu schrecklich, um
Realität zu sein.
Das Dorf, die
Heimat seiner Freunde und seiner Familie, am Ufer eines kleines Flusses
gelegen, existierte nicht mehr. Wie rauchgeschwärzte Skelette ragten die
wenigen, verbliebenen Zeltstangen in den Himmel, dazwischen lagen stille, unbewegte
Körper zwischen denen sich das Blau uniformierter Soldaten bewegte.
Es konnte nicht
wahr sein!
Aber noch während
sein Verstand die Tatsache leugnete, ließen sich der beißende Gestank nach Verbranntem
und Tod nicht länger verdrängen.
Mit einem entsetzlichen
Kriegsschrei trieb Wolfsauge sein Pony an und preschte den Hügel hinunter,
dicht gefolgt von den anderen Kriegern seines Stammes. Der Pfeil lag bereits
auf der Sehne des Bogens, noch ehe er wusste, dass er ihn angelegt hatte, aber
bevor er ihn todbringend davon schwirren lassen konnte, hörte er eine
unerwartete, aber vertraute Stimme.
"Gabriel,
nein! Wir sind es nicht gewesen!"
Wolfsauge zügelte
sein Pferd so heftig, dass es sich aufbäumte, während er versuchte, den
Besitzer der Stimme ausfindig zu machen. Endlich erspähte er ihn.
"Rafael!"
Sein Blick zuckte
weiter, suchte die, die ihm lieb und teuer waren, aber er fand niemanden.
Niemand kam, um ihn und die anderen Krieger zu begrüßen. Niemand …
Waren sie vor den
Soldaten geflohen? Das musste es sein! Sie waren geflohen, hatten sich in
Sicherheit gebracht und versteckt …
Seine Augen irrten
zurück zu Rafael, seinem Zwillingsbruder, der in der blauen Uniform der
Unionssoldaten noch immer ungewohnt wirkte, selbst nach all den Jahren, die er
jetzt im Dienste der Weißen stand.
"Wo sind
sie?", rief er anstelle einer Begrüßung. Rafe wusste auch so, wen er
meinte.
"Wo sind
sie?", wiederholte Gabriel, als Rafe nicht antwortete, sondern ihn nur mit
schmerzerfüllten Augen anstarrte.
"Rafe,
wo…" Seine Stimme erstarb, als Rafe nur bedauernd den Kopf schüttelte. Ein
Schrei entrang sich Gabriels Kehle. Qualvoll, wie der Todesschrei eines
waidwunden Tieres.
"Nein!!!"
Er glitt aus dem
Sattel und stürmte vor, aber Rafael hielt ihn zurück.
"Gabriel,
nein, tu dir das nicht an", beschwor er ihn, aber Gabriel schüttelte seine
Hände ab. Mit wildem Blick starrte er ihn an.
"Sie sind
meine Familie", krächzte er dann. "Ich muss zu ihnen." Seine
Hand zuckte zum Messer, so, als wäre er bereit, es sogar gegen seinen Bruder zu benutzen,
sollte dieser ihm weiter im Weg stehen. Ein weiterer Uniformierter kam auf sie
zu, aber Gabriel ignorierte ihn.
"Wo sind
sie?", keuchte er. Übelkeit stieg in ihm auf, während sein Herz sich noch
schmerzhafter zusammenzog. Aus der Ferne hörte er Kleiner Bärs entsetzlichen
Aufschrei. Sein Kopf zuckte hoch, aber er konnte seinem Freund in seiner Verzweifelung
nicht beistehen.
Ohne ein weiteres
Wort wandte Rafael sich um und ging voraus. Es war sinnlos, Gabriel von seiner
Familie fernhalten zu wollen. Er hatte es gewusst, aber er hatte einfach
versuchen müssen, ihm den Anblick zu ersparen. Gabriel folgte ihm mit schweren
Schritten. Vielleicht hatte Rafael sich geirrt. Vielleicht war es jemand anders,
jemand … Seine Hoffnung erstarb, als er die reglosen Gestalten erblickte. Mit
einem klagenden Laut sank er neben seiner Frau auf die Knie. Seine langen,
schwarzen Haare fielen nach vorn und bedeckten sein Gesicht, sodass er nicht
bemerkte wie Rafael dem Uniformierten, der auf ihn zuging, eine Hand auf den Arm
legte und verneinend den Kopf schüttelte. Es war offensichtlich, dass sein
Bruder keine Fragen zum Hergang des Überfalls beantworten konnte.
Überall im Lager
hörte man Schreie und Wehklagen, aber Gabriel vernahm es kaum. Seine zitternden
Hände glitten unter den reglosen Körper seiner Frau, doch als er ihn anheben
wollte, sank ihr Kopf haltlos nach hinten.
Ihr Genick war
gebrochen.
Ihre Kleidung war
zerrissen und blutig, und es war deutlich zu sehen, dass sie sich nicht
kampflos in ihr Schicksal ergeben hatte. Ihr langes, schwarzes Haar, das er so
geliebt hatte, war verschwunden – Beute eines Skalpjägers -, und Gabriel musste
sich zwingen, den Blick nicht voller Entsetzen von "Geht mit den
Wolkens" einst so liebreizenden, im Todeskampf jedoch grotesk erstarrten,
blutüberströmten Zügen, abzuwenden. Er stimmte einen Totengesang in der Tradition
des Volkes seiner Mutter an, als er den leblosen Körper seiner Frau an sich
zog. Dann streckte er seine bebenden Hände nach den beiden Bündeln aus, die
einmal seine Söhne gewesen waren. Ihre Köpfe waren kaum noch als solche zu erkennen.
Ausgelöscht.
Ihr Leben, ihre
Zukunft, sein Glück – vernichtet. Zerstört in einem einzigen Augenblick. Er
fühlte eine gähnende Leere in seinem Innern, einen seltsamen quälenden Schmerz,
mit nichts vergleichbar, was er jemals zuvor gespürt hatte. Es fühlte sich an,
als wäre mit seiner Familie auch ein Teil von ihm gestorben.
Er hörte das
Wehklagen der anderen, das Weinen der wenigen Frauen, die das Massaker überlebt
hatten und die jetzt, nach der Rückkehr des Jagdtrupps, aus ihren Verstecken
kamen. Er erwartete, dass sich jeden Augenblick seine eigenen Augen mit Tränen
füllen würden, aber sie taten es nicht.
"Es war
Taggart", hörte er wie aus weiter Ferne die Stimme seines Bruders.
"Es tut mir leid, Gabriel, dass ich ihn nicht früher zur Strecke gebracht
habe." Rafaels bernsteinfarbene Augen, den seinen so ähnlich, schienen von
innen heraus zu glühen, als er ihn anblickte und heiser schwor: "Aber ich
werde nicht ruhen, ehe ihr Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Ich werde
nicht ruhen, mein Bruder, das schwöre ich bei ihrem Tod und bei meinem
Leben."
Gabriel wusste,
dass Rafael jedes seiner Worte ernst meinte. Er würde nicht ruhen und nicht
rasten, ehe er die Mörder gestellt hatte und sie für ihr schändliches
Verbrechen bezahlt hatten. Er konnte die Schuldgefühle seines Bruders, die
Marodeure nicht aufgehalten zu haben, beinahe körperlich spüren, aber er hatte
nicht die Kraft, ihm zu versichern, dass er ihn nicht für den Tod seiner
Familie verantwortlich machte. Er selbst war es gewesen, der versagt hatte. Er
war es gewesen, der nicht da gewesen war, um sie zu beschützen. Er war auf
einem Jagdausflug gewesen, hatte mit seinen Freunden gescherzt und gelacht,
anstatt hier bei ihnen zu sein und sie zu verteidigen.
Langsam erhob er
sich. Der erkaltete Körper seiner Frau entglitt seinen Armen.
"Ich werde
dir helfen", sagte Rafael, aber Gabriel schüttelte den Kopf.
"Nein",
stieß er heiser hervor und schloss die Augen. "Es ist meine Aufgabe, sie
zu ihrer letzten Ruhe zu betten, damit sie den Frieden finden können, den sie
verdienen." Tief atmete er durch, aber seine Lunge fühlte sich an wie
zugeschnürt. Seine Beine waren schwer wie Blei, als er in die Mitte des Lagers
ging, das auf so unfassbare und schreckliche Weise fast vollständig zur
Begräbnisstätte geworden war. Dieser Ort würde niemals wieder ein Ort der
Lebenden sein. Überall errichteten die Krieger bereits Gerüste, auf denen die
Toten ihre letzte Ruhe finden sollten, ehe sie den Weg zum Großen Geist antraten.
Wie in Trance
schloss Gabriel sich ihnen an. Er fiel mit ein in den Totengesang, aber während
er überall um sich herum die Zeichen tief empfundener Trauer vernahm, fühlte er
gar nichts bis auf eine unerklärliche, scheinbar niemals wieder zu füllende Leere.
Als er die toten
Körper seiner Frau und seiner Kinder auf das Gerüst bettete, sie mit ihren
verbliebenen Habseligkeiten schmückte und ein letztes Gebet für sie sprach,
fühlte er, wie der Hass, verzehrend und alles vernichtend, begann, in ihm zu
wachsen und so die entstandene Leere bis in den letzten Winkel zu erfüllen.
Er würde die
Mörder jagen.
Er würde ihnen
nachstellen und sie zur Strecke bringen. Er würde sie hetzen wie ein Rudel
tollwütiger Hunde. Er würde keine Ruhe finden, ehe er sie nicht gerichtet und
für ihre Schandtaten zur Rechenschaft gezogen hatte. Und dennoch fragte er
sich, ob er selbst dann jemals wieder Ruhe und Frieden finden würde.
Er blickte ein letztes Mal auf die Grabgerüste, dann wandte er sich abrupt ab und schritt ohne einen weiteren Blick zurück davon.


